Top 5 Biomarker, die du regelmäßig tracken solltest – und warum
- 4. Juli 2025
- 12 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 10. Juli 2025

Gesundheit ist kein Glücksspiel – je mehr du über deinen Körper weißt, desto besser kannst du für dich sorgen. Bestimmte Biomarker (messbare Körperwerte) geben dir wichtige Hinweise auf dein Wohlbefinden. Hier erfährst du, welche fünf Werte du im Auge behalten solltest, was sie über deine Gesundheit verraten, wie du sie messen kannst und wie du sie auf natürliche Weise positiv beeinflusst. Keine Sorge: Du musst kein Arzt sein, um das zu verstehen – wir erklären alles einfach und motivierend!
Blutdruck – der Druck in deinen Adern
Was zeigt der Blutdruck? Dein Blutdruck misst den Druck, mit dem das Herz das Blut durch deine Gefäße pumpt. Die Werte werden in Millimeter Quecksilbersäule (mmHg) angegeben und bestehen aus zwei Zahlen: Systolisch (Druck beim Herzschlag) und diastolisch (Druck in der Entspannungsphase). Optimal sind etwa 120/80 mmHg. Steigen die Werte dauerhaft über ~140/90 mmHg, spricht man von Bluthochdruck (Hypertonie).
Warum ist das wichtig? Bluthochdruck tut nicht weh, kann aber großen Schaden anrichten – deshalb nennt man ihn oft einen lautlosen Killer. Er ist Risikofaktor Nummer 1 für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkt, Schlaganfall & Co... Herz-Kreislauf-Leiden sind die häufigste Todesursache überhaupt. In Europa hat fast jeder dritte Erwachsene hohen Blutdruck, viele ohne es zu wissen. Unbehandelt kann Hypertonie Gefäße schädigen, das Herz überlasten und Organe wie Gehirn oder Nieren beeinträchtigen. Kurz: Deinen Blutdruck im Griff zu haben, heißt dein Risiko für ernste Krankheiten senken.
Wie kannst du den Blutdruck messen? Zum Glück lässt sich der Blutdruck leicht kontrollieren. Du kannst ihn bei jedem Arztbesuch messen lassen – viele Apotheken bieten das ebenfalls an. Noch besser: Besorge dir ein Blutdruckmessgerät für zu Hause (Oberarm- oder Handgelenkgerät). Miss am besten morgens und abends in Ruhe. Moderne Wearables (z.B. einige Smartwatches) können Tendenzen erfassen, ersetzen aber nicht die genaue Messung mit Manschette. Notiere deine Werte, um Veränderungen zu verfolgen. So erkennst du frühzeitig, falls dein Blutdruck steigt, und kannst gegensteuern.
Tipps, um deinen Blutdruck natürlich zu verbessern:
Salzkonsum reduzieren: Zu viel Salz lässt den Blutdruck steigen. Die WHO warnt, dass übermäßiger Salzkonsum eine Hauptursache für Bluthochdruck ist. Versuche, Fertigprodukte und stark gesalzene Snacks zu meiden. Würze lieber mit Kräutern.
Ausreichend bewegen: Täglich schon 30 Minuten moderate Bewegung (zügiges Gehen, Radfahren, Schwimmen) wirken blutdrucksenkend. Regelmäßiger Sport stärkt Herz und Gefäße.
Gewicht im Blick halten: Falls du ein paar Kilo zu viel hast, kann Abnehmen helfen – jedes verlorene Kilo entlastet Herz und Gefäße.
Stress abbauen: Chronischer Stress kann den Blutdruck hochtreiben. Entspannungstechniken wie Yoga, Atemübungen oder Spaziergänge helfen, zur Ruhe zu kommen. Auch ausreichend Schlaf ist wichtig.
Genussmittel einschränken: Rauchen schädigt die Gefäße – ein weiterer Grund, damit aufzuhören. Alkohol nur in Maßen trinken, denn übermäßiger Konsum kann den Blutdruck erhöhen.
Blutzucker (HbA1c) – dein Langzeit-Energiespiegel
Was zeigt der Blutzucker bzw. HbA1c? Glukose (Zucker) ist der Treibstoff für deine Zellen. Der Blutzuckerwert gibt an, wie viel Glukose gerade im Blut kreist. Besonders wichtig ist der HbA1c-Wert, auch Langzeit-Blutzucker genannt. Dieser Laborwert zeigt den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten 2–3 Monate an. Er entsteht, weil sich Zucker an das Hämoglobin der roten Blutkörperchen anlagert. Ein HbA1c unter 5,7 % gilt als normal, ab ~6,5 % liegt ein Diabetes vor. Kurzfristig kannst du auch den nüchternen Blutzucker messen (normal <100 mg/dl). Beide Marker zusammen geben Auskunft über dein Diabetesrisiko.
Warum ist das wichtig? Diabetes (Zuckerkrankheit) ist auf dem Vormarsch – schätzungsweise jeder zehnte Erwachsene in Deutschland ist bereits betroffen, Tendenz steigend. Hoher Blutzucker über Jahre schädigt beinahe den ganzen Körper. Chronisch erhöhte Zuckerwerte attackieren die Innenwände der Gefäße und fördern Entzündungen. Die Folge: beschleunigte Arterienverkalkung, Herzschwäche und Durchblutungsstörungen. Menschen mit schlecht eingestelltem Diabetes haben ein stark erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Auch Nerven und Nieren können Schaden nehmen (diabetische Neuropathie, Nierenschäden), genauso Augen und Füße. Sogar leicht erhöhte Zuckerwerte (Prädiabetes) sind bereits ein Alarmzeichen und sollten ernst genommen werden. Die gute Nachricht: Durch Lebensstiländerungen lässt sich Typ-2-Diabetes oft verhindern oder verzögern.
Wie kannst du den Blutzucker messen? Für den HbA1c-Wert brauchst du einen Bluttest beim Arzt oder ein Labor-Heimkit. Beim Routine-Check-up ab 35 wird in der Regel auch der Nüchtern-Blutzucker bestimmt – frag ruhig nach deinem Wert. Zusätzlich kannst du mit einem Blutzuckermessgerät zu Hause selbst messen. Dafür pikst man sich in den Finger und trägt einen Tropfen Blut auf einen Teststreifen auf. Wer kein Problem mit Piksen hat, kann so gelegentlich prüfen, wie bestimmte Mahlzeiten den Zucker beeinflussen. Neuerdings nutzen manche Gesundheitsbewusste sogar CGM-Sensoren (Continuous Glucose Monitoring), die am Arm getragen werden und kontinuierlich den Zucker anzeigen – das war früher Diabetikern vorbehalten, wird aber populärer. Für die meisten reicht jedoch der gelegentliche Fingerpieks und vor allem der regelmäßige Arztcheck.
Tipps, um deinen Blutzucker natürlich zu verbessern:
Zucker und Weißmehl reduzieren: Süßgetränke, Süßigkeiten und weiße Brötchen lassen den Blutzucker rasch hochschießen. Besser: Vollkornprodukte, Gemüse und ballaststoffreiche Kost – die gehen langsamer ins Blut über und halten den Zucker stabiler.
Mehr Bewegung im Alltag: Muskulatur verbrennt Glukose. Schon ein Spaziergang nach dem Essen kann helfen, den Blutzuckeranstieg abzufedern. Regelmäßiger Sport verbessert zudem die Insulinempfindlichkeit – das Hormon Insulin wirkt effektiver, um Zucker in die Zellen zu schleusen.
Gewicht abnehmen, vor allem am Bauch: Bauchfett fördert Insulinresistenz. Wenn du es schaffst, ein paar Kilos loszuwerden, reagiert dein Körper oft wieder sensibler auf Insulin und der Blutzucker sinkt.
Ausgewogen essen statt crashen: Vermeide extreme Hungerphasen mit anschließendem Heißhunger. Besser sind regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten mit Proteinen, gesunden Fetten und komplexen Kohlenhydraten – das hält den Blutzuckerspiegel gleichmäßiger.
Stress und Schlaf im Griff: Chronischer Stress und Schlafmangel können den Blutzucker erhöhen (Stichwort Stresshormone). Gönn dir Entspannung und ausreichend Schlaf. Dein Stoffwechsel wird es dir danken.

Cholesterin – Fettwerte für Herz- und Gefäßgesundheit
Was zeigen Cholesterinwerte? Cholesterin ist ein fettähnlicher Stoff, den dein Körper braucht (z.B. als Baustein für Zellen und Hormone). Im Blut wird es in Paketen transportiert: vor allem als LDL (Low Density Lipoprotein) und HDL (High Density Lipoprotein). Vereinfacht gesagt: LDL-Cholesterin liefert Cholesterin zu den Zellen – zu viel davon kann sich jedoch in den Gefäßwänden ablagern und zu Arterienverkalkung (Arteriosklerose) führen. Deshalb nennt man LDL, das „schlechte“ Cholesterin. HDL-Cholesterin dagegen sammelt überschüssiges Cholesterin ein und bringt es zur Leber zurück – es gilt als das „gute“ Cholesterin. Wichtig sind also niedrige LDL und hohe HDL-Werte. Oft wird auch das Triglycerid gemessen (eine andere Fettart im Blut). Ein Bluttest (Lipidprofil) gibt Auskunft über alle diese Werte. Optimal bei gesunden Menschen sind z.B. LDL < 116 mg/dl, HDL > 40 mg/dl, (je nach Risikofaktoren empfiehlt man noch niedrigere LDL-Ziele).
Warum ist das wichtig? Hohe Cholesterinwerte – insbesondere LDL – erhöhen das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich. Je höher dein LDL-Spiegel, desto höher die Wahrscheinlichkeit, eine Herzkrankheit oder einen Schlaganfall zu erleiden. Überschüssiges LDL-Cholesterin lagert sich in den Arterien ab und fördert die Plaquebildung. Diese Plaques können Gefäße verengen oder sich lösen und Gefäßverschlüsse verursachen (Herzinfarkt, Schlaganfall). Tatsächlich ist ein dauerhaft hohes LDL einer der stärksten Risikofaktoren für Herzinfarkt. Umgekehrt schützt ein günstiges Cholesterinprofil dein Herz: In sauberen Gefäßen kann das Blut ungehindert fließen. Da Herz-Kreislauf-Leiden so häufig sind, lohnt es sich für jeden, auf die Cholesterinwerte zu achten – selbst wenn man sich topfit fühlt.
Wie kannst du Cholesterin messen? Meist geschieht das über einen Bluttest beim Hausarzt. Im Rahmen von Check-ups oder Blutspenden wird oft automatisch das Lipidprofil erstellt. Frag einfach nach deinen Zahlen (LDL, HDL, Triglyceride, Gesamtcholesterin). Beachte: Für genaue LDL-Werte soll man meist nüchtern erscheinen (8–12 Stunden nichts gegessen haben). Es gibt auch Selbsttests für Cholesterin – z.B. Teststreifen für einen Bluttropfen aus dem Finger – doch die sind oft ungenau. Verlass dich lieber auf Laborwerte. Wenn deine Werte grenzwertig sind, wird der Arzt ggf. eine engmaschigere Kontrolle empfehlen. Ansonsten reicht es in der Regel, alle paar Jahre mal hinzuschauen, solange du gesund bist. Bei bereits bekannt hohem Cholesterin natürlich öfter kontrollieren.
Tipps, um deine Cholesterinwerte natürlich zu verbessern:
Gesunde Fette statt ungesunde: Reduziere gesättigte Fettsäuren und Transfette. Das heißt weniger fette Wurst, rotes Fleisch, Butter, frittierte und industrielle Backwaren. Setze stattdessen auf ungesättigte Fettsäuren aus Fisch (Omega-3 in Lachs, Makrele), Avocado, Olivenöl, Rapsöl, Nüssen und Samen. Diese können LDL senken und HDL leicht erhöhen.
Ballaststoffe und Pflanzenpower: Mehr Ballaststoffe helfen, Cholesterin auszuleiten. Iss reichlich Gemüse, Obst, Haferflocken, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Speziell Hafer und Leinsamen enthalten lösliche Ballaststoffe (Beta-Glucan), die erwiesenermaßen den LDL-Spiegel senken können.
Bewegung und Sport: Durch regelmäßige Bewegung steigt das „gute“ HDL-Cholesterin an. Schon 30 Minuten moderate Aktivität täglich unterstützen ein besseres Fettprofil. Finde etwas, das dir Spaß macht – Hauptsache, du kommst in Schwung!
Nicht rauchen & Alkohol mäßigen: Rauchen senkt das schützende HDL und schädigt die Gefäße – ein doppelter negativer Effekt. Der Verzicht aufs Rauchen verbessert deine Blutfette und reduziert Entzündungen. Auch Alkohol sollte nur in Maßen genossen werden (ein Glas Wein am Abend ist ok, eine Flasche eher nicht).
Idealgewicht anstreben: Falls du übergewichtig bist, wirkt sich schon eine moderate Gewichtsabnahme positiv auf deine Cholesterinwerte aus. Insbesondere Bauchfett hängt mit ungünstigen Fettwerten zusammen (Stichwort metabolisches Syndrom). Mit jedem Kilo weniger wird meist auch LDL etwas fallen.
(Hinweis: Manche Menschen haben familiär bedingt hohe Cholesterinwerte. Wenn Lebensstilmaßnahmen nicht ausreichen, besprich mit deinem Arzt weitere Optionen. Es gibt sehr effektive Medikamente (Statine u.a.), um LDL zu senken – Gesundheit geht vor Skepsis.
Entzündungsmarker (CRP) – Alarmglocke des Immunsystems
Was zeigt CRP? C-reaktives Protein (CRP) ist ein Eiweiß, das deine Leber ausschüttet, wenn irgendwo im Körper eine Entzündung schwelt. Es gehört zur Immunabwehr und steigt bei Infektionen oder Gewebeschäden rasant an. Im Alltag meint man mit „CRP-Wert“ häufig das high-sensitivity CRP (hsCRP), eine empfindliche Messung, die auch geringe Entzündungen aufspürt. Normale CRP-Werte liegen unter 5 mg/L (bzw. <0,5 mg/dL). Bei Infekten kann CRP auf über 100 hochschießen. Interessant für die Vorsorge ist aber vor allem der niedriggradige Entzündungsstatus: Ein hsCRP von z.B. 1–3 mg/L gilt als Hinweis auf möglicherweise erhöhte Entzündungsaktivität im Körper. Über 3 mg/L (ohne akute Infektion) bedeuten ein deutlich erhöhtes Risiko, dass in den Gefäßen Entzündungsprozesse ablaufen – das kann die Entwicklung von Arteriosklerose fördern.
Warum ist das wichtig? Chronische, unterschwellige Entzündungen stehen im Verdacht, an vielen Zivilisationskrankheiten beteiligt zu sein – von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Diabetes bis zu bestimmten Autoimmunerkrankungen. Ein ständig leicht erhöhtes CRP kann z.B. auf entzündliche Ablagerungen in den Blutgefäßen hindeuten, die das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. Mittlerweile wird CRP daher auch als Risikomarker fürs Herz genutzt: Studien zeigen, dass Menschen mit hohem CRP häufiger Herzprobleme bekommen, selbst wenn ihr Cholesterin okay ist. Auch bei Krankheiten wie Rheuma, chronisch-entzündlichen Darmleiden oder versteckten Infektionen ist CRP erhöht. Kurz gesagt: CRP ist wie ein Rauchmelder – es schlägt Alarm, wenn irgendwo “Feuer“ (Entzündung) im Körper ist. Dauerhaftes „Glimmfeuer” ist ungesund. Daher lohnt es sich, auf entzündungshemmenden Lebensstil zu achten.
Wie kannst du CRP messen? Den CRP-Wert erfährst du über einen Bluttest. Bei Verdacht auf Infektionen oder Entzündungen wird er vom Arzt routinemäßig bestimmt. Im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen gehört CRP (noch) nicht standardmäßig dazu. Aber immer mehr Menschen lassen auf eigenes Wunsch einmal jährlich ein hsCRP messen, um stille Entzündungen aufzudecken – zum Beispiel über Direktlabor-Angebote oder Selbstzahler-Leistungen beim Arzt. Manche umfangreichen Gesundheits-Checks oder Bluttest-Pakete für zu Hause enthalten hsCRP bereits. Wichtig: CRP ist unspezifisch. Ein hoher Wert sollte immer von einem Arzt eingeordnet werden. Bei einer Erkältung oder Zahninfektion ist CRP z.B. vorübergehend hoch – das bedeutet nicht gleich Herzrisiko. Deshalb lieber mehrfach und im gesunden Zustand messen, um deinen Basiswert zu kennen.
Tipps, um Entzündungswerte (CRP) natürlich zu senken:
Die mediterrane Ernährung: Eine bunte Kost reich an Obst, Gemüse, Vollkorn, Nüssen, Olivenöl und Fisch liefert entzündungshemmende Nährstoffe. Omega-3-Fettsäuren aus fettem Fisch (Lachs, Hering) oder Leinsamen können Entzündungsmarker senken. Ebenso werden Gewürze wie Kurkuma und Ingwer antientzündliche Effekte nachgesagt.
Übergewicht abbauen: Fettgewebe (besonders am Bauch) produziert entzündungsfördernde Botenstoffe. Weniger Bauchfett = weniger chronische Entzündung. Studien zeigen, dass Gewichtsabnahme oft mit einem Absinken des CRP-Spiegels einhergeht.
Regelmäßig bewegen: Bewegung drosselt auf Dauer die Entzündungsaktivität im Körper. Moderater Ausdauersport, Krafttraining oder einfach tägliche Aktivität – such dir aus, was dir liegt. Wichtig: Nicht übertreiben – sehr intensiver Sport kann kurzfristig Entzündungswerte erhöhen. Die Dosis macht das Gift!
Nicht rauchen: Rauchen erhöht chronisch die CRP-Werte und schädigt das Gefäßinnenleben. Ein rauchfreies Leben ist das Beste, was du für deine Gefäße tun kannst.
Stress reduzieren: Dauerstress kurbelt entzündungsfördernde Hormone an. Gönn dir Pausen und Entspannung. Ausreichender Schlaf (7–8 Stunden) hilft ebenfalls, den Körper zu regenerieren. Chronische Entzündung kann nämlich auch durch Schlafmangel begünstigt werden.
(Merke: Ein gesunder Lebensstil – ähnlich wie bei Blutdruck und Cholesterin – wirkt oft auf mehrere Risikofaktoren gleichzeitig positiv. So schlägst du mehrere Fliegen mit einer Klappe.
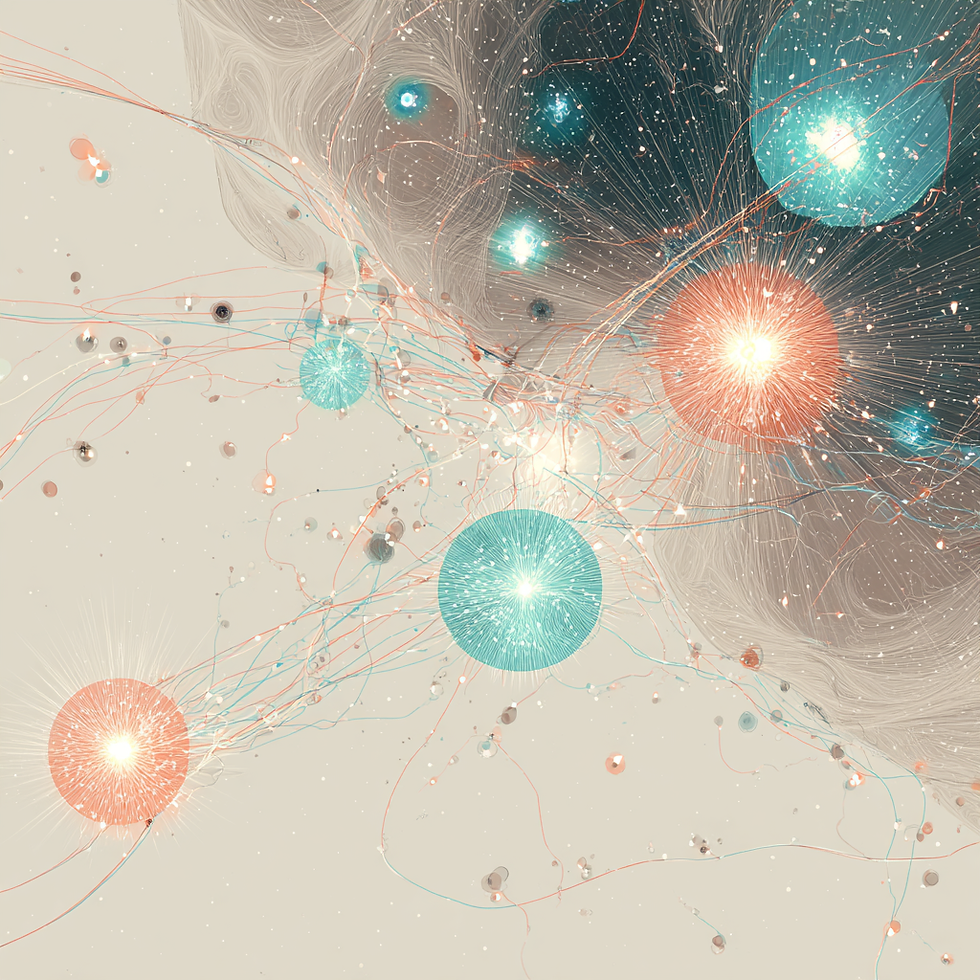
Vitamin D – der Sonnenschein für deine Gesundheit
Was zeigt Vitamin D? Vitamin D ist ein besonderer Vitalstoff: Dein Körper kann ihn mithilfe von Sonnenlicht selbst bilden. Gemessen wird meist das 25(OH)-Vitamin-D im Blut, das Auskunft über deine Vitamin-D-Versorgung gibt. Werte ab ca. 50 nmol/L (20 ng/ml) gelten vielen Experten als ausreichend, manche empfehlen sogar 75 nmol/L (30 ng/ml) als Ziel. Werte unter 30 nmol/L (12 ng/ml) bedeuten einen echten Mangel, der schon zu gesundheitlichen Problemen führen kann (z.B. Knochenerweichung). Vitamin D ist essenziell für den Kalziumhaushalt und starke Knochen. Darüber hinaus beeinflusst es zahlreiche Stoffwechselprozesse, die Muskelfunktion, das Nervensystem und das Immunsystem. Es wird deshalb oft das “Sonnenvitamin” genannt – ohne genug Sonne sinkt der Spiegel.
Warum ist das wichtig? Ein guter Vitamin-D-Spiegel trägt zur Knochengesundheit bei und kann Osteoporose vorbeugen. Ohne Vitamin D kann der Körper Kalzium aus der Nahrung schlecht aufnehmen – die Knochen werden weich oder brüchig (Stichwort Rachitis bei Kindern, Osteomalazie bei Erwachsenen). Außerdem unterstützt Vitamin D die Immunabwehr: Forschung deutet darauf hin, dass Vitamin-D-Mangel mit schwächerer Immunfunktion und höherer Anfälligkeit für Infekte und Autoimmunerkrankungen einhergehen kann. Viele Menschen haben vor allem im Winter niedrige Vitamin-D-Werte, weil die Sonne in unseren Breiten dann zu tief steht. Laut Studien weisen rund 15 % der Erwachsenen in Deutschland einen Vitamin-D-Spiegel unter 12 ng/ml auf – also echten Mangel. Etwa 30 % haben einen Wert unter 20 ng/ml, was als insuffizient gilt. Ein Mangel kann Müdigkeit, Muskelschwäche und Infektanfälligkeit verursachen. Aber auch wer keine Symptome spürt, profitiert langfristig davon, ausreichend versorgt zu sein – für stabile Knochen, ein fittes Immunsystem und möglicherweise ein geringeres Risiko für chronische Krankheiten. Kurzum: Vitamin D ist klein, aber oho!
Wie kannst du Vitamin D messen? Den Vitamin-D-Spiegel erfährst du über einen Bluttest. Du kannst beim Hausarzt danach fragen (oft muss man ihn allerdings selbst bezahlen, da er nicht routinemäßig in den Check-ups drin ist – außer es besteht ein konkreter Verdacht auf Mangel). Alternativ gibt es Selbsttests: Du bestellst ein Testkit, piekst dich in den Finger und schickst ein paar Tropfen Blut ins Labor. Auch einige Apotheken bieten Vitamin-D-Tests an. Wichtig: Lass idealerweise im Spätwinter/Frühjahr messen, da dann die Speicher am leersten sind. So erkennst du, ob du über den Winter ausreichend versorgt warst. Im Sommer synthetisieren viele genug in der Haut – aber auch da kann Mangel bestehen, je nach Lebensstil. Ein Wert im mittleren Normalbereich (~20–30 ng/ml) gilt als unbedenklich. Ist er niedriger, kannst du gegensteuern (siehe Tipps). Achtung: Extrem hohe Vitamin-D-Werte durch Überdosierung sind ebenfalls ungesund – immer vernünftig supplizieren, falls nötig, und nicht „viel hilft viel”.
Tipps, um Vitamin D auf natürliche Weise zu tanken:
Sonnenlicht nutzen: Geh regelmäßig mit unbedeckten Armen und Gesicht in die Sonne – ungefähr 2–3-mal pro Woche für 10–20 Minuten, je nach Hauttyp und Uhrzeit. Die Mittagssonne liefert das meiste UVB (für Vitamin-D-Bildung nötig), aber Vorsicht vor Sonnenbrand! Kurz und effektiv sonnen, dann wieder schützen. Im Winter steht die Sonne in Deutschland zu tief – da ist es schwierig, genug zu bilden.
Vitamin-D-reiche Lebensmittel: Viele Nahrungsmittel enthalten wenig Vitamin D, aber ein paar Ausnahmen gibt’s: Fetter Seefisch (z.B. Hering, Lachs, Makrele) ist ein guter Lieferant. Auch Eigelb und Pilze (vor allem solche, die unter UV-Licht gewachsen sind) enthalten etwas Vitamin D. In einigen Ländern wird Milch oder Saft damit angereichert – in Deutschland hauptsächlich Margarine. Ernährung allein ersetzt jedoch meist nicht die Sonne.
Gezielte Nahrungsergänzung: Insbesondere im Herbst und Winter kann ein Vitamin-D-Supplement sinnvoll sein, wenn dein Wert niedrig ist. Gängige Dosen für Erwachsene liegen um 800–2000 I.E. (Internationale Einheiten) pro Tag. Lass dich am besten von deinem Arzt beraten, welche Dosis für dich passt – vor allem bei höheren Dosierungen, damit es nicht zu viel des Guten wird. Vitamin D sollte man idealerweise zusammen mit Vitamin K2 und Magnesium in ausreichender Menge haben, damit das Kalzium richtig verwertet wird (das führt hier aber zu weit).
Bewegung an der frischen Luft: Zwei Fliegen mit einer Klappe – draußen spazieren gehen, steigert nicht nur deine Fitness, sondern liefert auch etwas Sonnenlicht, selbst wenn es bewölkt ist. Außerdem kurbelt es den Stoffwechsel an. Dein Körper ist ein komplexes System: Bewegung kann indirekt helfen, den Vitamin-D-Stoffwechsel zu optimieren.
Auf Risikofaktoren achten: Ältere Menschen, Menschen mit dunklerer Haut, Schichtarbeiter oder Personen, die sich kaum im Freien aufhalten, haben ein höheres Risiko für Vitamin-D-Mangel. Gehörst du dazu, lohnt es sich besonders, deinen Spiegel prüfen zu lassen und ggf. zu supplementieren. Gleiches gilt, wenn du unter chronischen Darm-, Leber- oder Nierenkrankheiten leidest, die die Vitamin-D-Aufnahme oder -bildung stören können.

Dein persönlicher Gesundheitscheck
Du merkst: Hinter abstrakten Begriffen wie HbA1c oder CRP verbergen sich wichtige Geschichten über deine Gesundheit. Diese fünf Biomarker – Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin, Entzündungswert und Vitamin D – bilden eine solide Grundlage, um deinen Gesundheitszustand einzuschätzen. Das Tolle ist, dass du selbst aktiv werden kannst: Durch regelmäßiges Tracken (sei es beim Arzt, mit HomeKits oder smarten Gadgets) erkennst du Veränderungen frühzeitig. So kannst du gegensteuern, bevor sich Krankheiten manifestieren. Alle genannten Marker lassen sich durch einen bewussten Lebensstil positiv beeinflussen – gesunde Ernährung, Bewegung, Stressmanagement und Verzicht auf Laster sind wahre Wunderwaffen, die gleich mehrere Werte verbessern.
Nimm deine Gesundheit also in die eigene Hand! Starte vielleicht mit einem Check-up beim Arzt, um deine Baseline zu ermitteln. Dann setz dir kleine Ziele: z.B. täglich 15-Minuten-Spaziergang extra (gut für Blutdruck und Blutzucker), einen Obst- und Gemüsetag pro Woche einlegen (für Cholesterin und Entzündungshemmung) oder in der Mittagspause etwas Sonne tanken (für Vitamin D). Jeder Schritt zählt. Mach es zu einem Spiel, deine Biomarker nach und nach in den grünen Bereich zu bringen. Du musst nicht perfekt sein – es geht um Fortschritte. Und vergiss nicht, dich über Erfolge zu freuen: Sinkt dein Blutdruck oder hältst du den Blutzucker stabil, ist das ein echter Gewinn für deine langfristige Gesundheit.
Bleib locker und motiviert dabei – dein Körper wird es dir danken! Mit dem Wissen über diese fünf Biomarker hast du ein mächtiges Toolset an der Hand, um Krankheiten vorzubeugen und dich jeden Tag fitter zu fühlen. Also, auf geht’s: Tracke deine Gesundheit und hab Spaß daran, der beste Gesundheitsmanager in eigener Sache zu sein!
Quellen: Die im Text aufgeführten Fakten sind durch wissenschaftliche Studien und Empfehlungen belegt, z.B. durch Daten der Deutschen Hochdruckliga, der WHO, der Deutschen Diabetes Gesellschaft, der Deutschen Herzstiftung, dem Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung, aktuellen Gesundheitsportalen und Fachartikeln. Weiterführende Informationen findest du unter den angegebenen Referenzen.


Kommentare